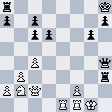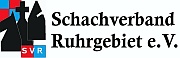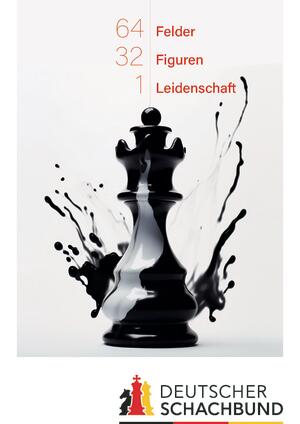Die Schönheit des Spiels
(Artikel erschienen 2018 anlässlich des damals in Berlin stattfindenden Kandidatenturniers)
Ein Schachturnier auf Weltklasseniveau kann man sich in etwa wie eine Anne-Imhof-Performance vorstellen – zwar ohne Drohnen und Falken, dafür mit feinem Zwirn vom Herrenausstatter. Es gibt vielsagende Blickduelle, beredtes Schweigen, passiv-aggressives Herumgetiger und perfekt choreografierte Auf- und Abtritte mit flüchtigen Begegnungen. Und es dauert lange.
Eine besonders beeindruckende Aufführung dieser Art findet derzeit im Berliner Kühlhaus statt, wo die acht besten Großmeister der Welt in Totenstille und roher Hipsterarchitektur einen Herausforderer für den amtierenden Schachweltmeister Magnus Carlsen unter sich ausspielen. In vier Kabinen halten sich die hyperkonzentrierten Kontrahenten die Köpfe, als könnte ihnen beim Denken das Gehirn herausfallen. Zwischendurch springen sie auf, umrunden im Stechschritt mit quietschenden Gummisohlen die Bretter der anderen, während ihnen das (überwältigend männliche) Publikum über Stunden andächtig von einer Empore zusieht.
Wenn man Schach nicht versteht, ist das Spiel ein verwirrendes Figurenrücken auf schwarzweißen Feldern, dem erstaunlich viel Aufmerksamkeit zuteil wird. Wenn man sich jedoch in die Welt der Könige, Damen und Bauern begibt, in der Berliner Mauern errichtet, Turmopfer dargeboten und Marshall-Angriffe geritten werden, ist Schach eine Kunstform. Kein anderes Spiel ist in der Kunstgeschichte so oft dargestellt worden: als politische Machtmetapher auf Herrscherbildern, als adliger Zeitvertreib in der Renaissance, bei dem auch Frauen ernst genommen wurden, und als bürgerliche Flirtpartie in der Salonmalerei des 18. und 19. Jahrhunderts, in der die Damen jenseits des Spielfelds gern edel gelangweilt wirken.
Den uralten Denksport, der im Mittelalter über Indien und Persien nach Europa importiert wurde, umweht wie kein anderes Spiel eine Aura von Genialität, gemischt mit einer Prise Wahnsinn. Nicht wenige Großmeister haben sich auf dem karierten Brett verloren, ein ruheloser Geist kann ewig über den unendlichen Möglichkeiten brüten, für immer kreative Ideen entwickeln oder weniger fantasievolle Hirne in die Falle locken. Alexander Aljechin, Bobby Fisher, Garri Kasparow: die Schachgeschichte ist voll von exzentrischen Persönlichkeiten.
Insofern ist es nicht verwunderlich, dass Schach auch ein Spiel der Künstler ist. Marcel Duchamp, dem immer wieder die alleinige Erfindung der Konzeptkunst auf die Schultern geladen wird, sah sich selbst vor allem als Schachspieler – und als Geschädigter des intellektuellen Suchtmittels. "Ich bin ein Opfer des Schach", sagte Duchamp, der 1963 während seiner Retrospektive im Pasadena Art Museum eine legendäre Partie gegen die nackte Autorin Eve Babitz spielte, hier nachgestellt vom britischen Künstler Peter Blake
"Schach hat all die Schönheit von Kunst - und noch viel mehr davon." Dieser fordernden Schönheit unterwarf sich Duchamp immer wieder. In den 20er-Jahren zog er sich gänzlich aus der Kunstwelt zurück und spielte bis 1933 in fünf Schach-Olympiaden für die französische Mannschaft. Seine Leidenschaft teilte Duchamp mit Künstlerkollegen wie Man Ray oder Max Ernst, die ihrer Hingabe mit eigens designten Schachsets Ausdruck verliehen.
Auch Bauhaus-Dozent Josef Hartwig und Traumjäger Salvador Dali gaben den jahrhundertealten Figuren ihre individuellen Formen. Dass Dalis Bauern und Läufer, die eigentlich Finger sein sollen, an metallisch glänzende Dildos erinnern, dürfte kein Zufall sein.
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde Schach nicht nur zur Lieblingsbeschäftigung des "Boy's Club" der europäischen Künstleravantgarde, sondern auch zu einer Requisite erotischer Fantasien. 1913 malte Ernst-Ludwig Kirchner seine Kollegen Erich Heckel und Otto Mueller beim Schachspiel mit freiem Oberkörper. Während die beiden Herren immerhin noch Hosen tragen, räkelt sich auf einem Sofa im Hintergrund eine nackte Frau, die das Geschehen auf dem Brett zu verfolgen scheint. Ob sie Kampfrichterin, Staffage oder Siegprämie ist, lässt sich schwer entscheiden.
Auch die Surrealisten malten sich das Schachbrett als erregenden Ort aus. René Magritte verlieh seinen Figuren auf der Leinwand verführerisch weibliche Kurven, Salvador Dali ließ seinen Narziss vor einem Schachbrettmuster erblühen und verderben.
Wer mucksmäuschenstill einer sechsstündigen Schachpartie zuschaut, hat viel Zeit, diesen kunstgeschichtlichen Ballast auf die denkenden Herren in der Arena abzuladen. Schach ist ein Fleißsport, der heute vor allem von Computern geprägt wird. Seine Aura aus Geist, Kunst und einer verkopften Sexyness hat er trotzdem nicht eingebüßt. Wer es ein wenig robuster mag (und wer nicht sechs Stunden lang schweigen kann), dem sei die alternative Disziplin Schachboxen ans Herz gelegt, die 2003 vom Aktionskünstler Iepe Rubingh in Berlin erfunden wurde. Beim Chess Boxing, das inzwischen internationale Beliebtheit genießt, duellieren sich die Gegner abwechselnd jeweils drei Minuten am Schachbrett und im Boxring. Der Kampf endet dann, wenn jemand körperlich oder geistig k.o. geht. Die handgreiflichen Einlagen geben dem stillen Grübeln heitere Absurdität und Spektakelcharakter – könnten aber ein paar Gehirnzellen kosten.
Die ehrgeizigen Großmeister aus dem Kühlhaus werden sich aus diesem Grund wohl kaum zu einem der Schachbox-Alternativevents in Berlin hinreißen lassen. Und Weltmeister Magnus Carlsen, der in seiner Heimat Norwegen Popstarstatus genießt und bereits vom US-Maler William Wright in Öl verewigt wurde, kann ganz in Ruhe abwarten, wer ihn im November in London herausfordern wird. Den Satz von Marcel Duchamp, dass er eher Schachspieler als Künstler sei, hat Carlsen übrigens charmant umgedreht. Er sehe sich nicht so sehr als Denksportler, sagte er der BBC, sondern eher als Künstler.
Autorin: Saskia Trebing, Monopol-Magazin (2018)
https://www.monopol-magazin.de/die-schoenheit-des-spiels?slide=0