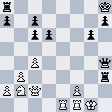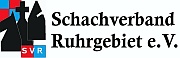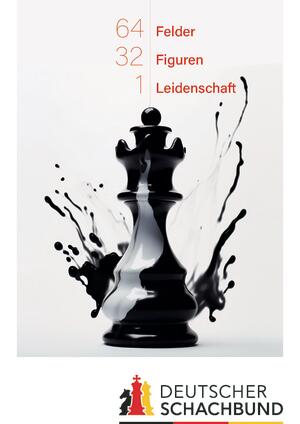(Lesezeit: 10 min)
„Hey Joe, nu hör schon auf zu daddeln, verdammt! Das letzte T-Bone-Steak von deim Leben liegt vor dir auffem Teller und wird kalt, Smiley von der Küche hat sich extra Mühe gegeben, was sons nich seine Art is, das wissen wir - willsde etwa mit leerem Magen vor dein Schöpfer treten, verdammt, was zocksden da überhaupt und mit wem?“
Doch Joe, der gerade so freundlich Angesprochene, ein Angehöriger der „People of Color“ selbstredend, ein Farbiger also, wie es sich für die Knäste in den US-Südstaaten geziemt, lässt sein Smartphone-Display nicht aus den Augen und würdigt seinen Wärter im Todestrakt des Bundesgefängnisses von Alabama keines Blickes: „Verstehse doch nich, Bob, Online-Schach, bin kurz vor 2500 Elo, erste Mal in meim Leben – und wohl auch letzte Mal, wenn nich der Gouverneur um Zwölf anruft – nur die eine Partie hier noch, dann habbich die Schallmauer geknackt!“.
Wir wissen nicht, liebe Schachfreunde, wie es für Joe weiterging, ob ihn der Gouverneur noch begnadigt hat in letzter Minute und ob er die 2500 noch geknackt hat, auf jeden Fall dürfte aber das von Smiley in der Küche so liebevoll zubereitete T-Bone-Steak tatsächlich kalt geworden sein, denn Online-Schach zieht seine Akteure mit Macht in seinen Bann. Lange bin ich selbst abstinent gewesen, hauptsächlich gehandicapt durch einen langsamen PC, von dem ich mich nicht trennen wollte, doch vor ein paar Monaten bin ich schließlich mit neuer Hardware der Faszination des Online-Zockens bei chessbase erlegen.10 Minuten Bedenkzeit pro Partie ohne Inkrement im anonymen Modus sind, so fand ich schnell heraus, für mich die bekömmlichen Spielbedingungen. Für die, die es nicht kennen: Jeder Neueinsteiger kriegt automatisch 1700 "Elo" als Start- und Spielkapital. Von da an geht es dann mit jeder gespielten Partie aufwärts oder abwärts. Die Extreme waren bisher 1300er, die sich ohne Gegenwehr arglos narrenmattsetzen ließen und 3800er, bei denen die meisten Gegner wohl erschreckt noch vor dem ersten Zug die Partie abbrechen. Keine Ahnung, was für Leute da mitspielen – vielleicht zum Spaß mal Nakamura oder Karjakin oder aber nur Otto Normalspieler, die Gefallen daran finden, ihre Zahl durch permanentes Gegnerablehnen in solch schwindelerregende Höhen zu treiben (habe ich selbst „just for fun“ mal probiert: Bei 4000 ist dann aber Schluss und das System stuft einen gnadenlos wieder runter auf 1700 und man kommt sich vor wie im Märchen vom Fischer und seiner unersättlich nach Besitz, Ruhm und Einfluss gierenden Frau, die beide am Ende wieder in ihrer armseligen Fischerhütte landen).
Da wir gerade bei unangenehmen Tricks sind: Manche Zeitgenossen, die ein paar hundert „Elo“ weniger als man selbst auf dem Konto haben, hauen am Anfang ein paar Standard-Züge aufs Brett und steigen dann plötzlich aus, gehen aufs Klo oder machen sonstwas, während sie darauf hoffen, dass du - zur Untätigkeit verdammt auf ihren nächsten Zug wartend – nach ein paar Minuten entnervt die Brocken hinschmeißt. Manchmal nützt dann der Button „Reklamieren“, manchmal nicht, dann heißt es entweder warten auf Ablauf der gegnerischen Bedenkzeit oder Punkte verlieren.
Die verehrte Gegnerschaft an sich ist in der ganzen Welt beheimatet, alle Kontinente und damit auch alle Zeitzonen sind vertreten, amerikanische Pizzabäcker aus Little Italy können um 3.30 MEZ gegen noch schlaftrunkene ostfriesische Krabbenfischer antreten oder ein argentinischer Gaucho in der sprichwörtlichen Pampa nach Feierabend gegen einen englischen Butler aus North-Cothelstone-Hall/Nether Addelthorpe.
Über seine Gegner als Individuen weiß man aber nichts, so gut wie immer geht man nach der Partie wortlos auseinander, verärgerte Verlierer verkneifen sich sogar den üblichen Höflichkeitsapplaus an den Sieger. Die „Shortcuts“, also die anklickbaren Standardfloskeln, bieten ein eher beschränktes Reaktionspotential: Schickt man einem unglücklichen Verlierer noch ein „Have a nice day“ hinterher, dann könnte das höhnisch klingen. Und ein „You played well, thank you for the game“ könnte zu Recht als Ironie gewertet werden, wenn der Kontrahent sich seekadettenlike hat mattsetzen lassen. Deshalb verzichte ich grundsätzlich auf solche Versatzstücke und applaudiere nur immer artig mit Applaus und kurzen Lachern aus der Konserve, wenn der Gegner gewonnen hat, auch bei Remis - und sogar bei eigenem Gewinn, wenn der Gegner nach Elo weit schwächer war und trotzdem zähen Widerstand geleistet hat.
Wer sitzt einem aber da aber als Spieler-Typ virtuell gegenüber, mit wem hat man es insofern zu tun? Prinzipiell kommen zwei Gruppen in Frage: einmal die, die am heimischen PC oder auch in der Mittagspause am PC im Büro sitzen und die relativ wenig Ablenkung und Störung zu gewärtigen haben. Hier kann man mit einem einigermaßen gleichbleibenden Spielniveau über den ganzen Partieverlauf rechnen – wenn auch mit Ausnahmen, wenn beim Gegner der Paketbote klingelt, der Nachbar bei offenem Fenster unverhofft den Rasenmäher anwirft oder der Chef einem einen dringlichen Vorgang zwischen PC und Mittagsmenü auf den Schreibtisch schleudert mit den Worten: „Das muss heute noch raus!“
Bei der zweiten Gruppe, den Smartphonedaddlern, ist nahezu jede Störung möglich und damit auch ein extrem schwankendes Spielniveau: Feuerwehrleute werden abrupt zum Einsatz gerufen, Bereitschaftsärzte und Rettungssanitäter zu einem Notfall geschickt, dem Kommandanten eines russischen Atom-U-Bootes wird gar nahegelegt, sich für den dritten Weltkrieg gefechtsbereit zu machen (bin kein Techniker und weiß nicht ob und wie tief es für U-Boote WLAN oder sonstiges gibt). In solchen Fällen gibt der Gegner meistens auf, manchmal sehr überraschend nur drei Sekunden, bevor man mit 15 Bauerneinheiten im Minus selbst die Segel streichen wollte. Ein weiterer Störfaktor ist die Meldung „disconnected“, was gerade bei Spielpartner aus der „Dritten Welt“ (Jutta Ditfurth würde es „Trikont“ nennen) nicht selten vorkommt. Dies kann an der Technik liegen, stelle ich mir vor (Kabeldiebe etwa zerschneiden während der laufenden Partie „systemrelevante“ Kupferkabel, wo noch kein Glasfaser liegt), oder aber auch daran, dass zeitweise schlicht kein Netz vorhanden ist (wenn das Feuerwehrauto durch den Elbtunnel fährt). Oder der daddelnde Businessman gerät in ein Funkloch in der Londoner Metropolitan Line.
Grundsätzlich dürften die Gegner aus allen Schichten und Berufsgruppen kommen. Bei Spielpartnern aus dem Osten (Russland oder dem Balkan) ist es gut möglich, dass ein hoher Anteil Frauen sind. Krankenschwestern, Architektinnen oder Kranführerinnen (bei letzteren kann die Konzentration auf die Partie schon mal von der Arbeitswelt ablenken und die 50 Meter unter ihr Arbeitenden sind gut beraten ihren Schutzhelm zu tragen). Zahnärzte oder Chirurgen dagegen werden hoffentlich selten unter den schachlichen Akteuren sein; selbst wenn genug fachkundige Assistenten dabei sind, die fehlende Hand zu ersetzen, so kostet ein konzentriertes Spiel während der OP oder der Zahnextraktion doch so viel Aufmerksamkeit, dass man solche Mediziner als Patient besser meiden sollte.
Ein Umstand, der mich persönlich besonders nervt: Ist man in hochgradiger Zeitnot, kriegt man das vom Programm manchmal auch noch genüsslich unter die Nase gerieben. Die Sekunden schwinden dahin, bei unter 10 rattern sogar noch die Zehntel sichtbar von dannen und man starrt auf die Anzeige wie das Kaninchen auf die Schlange, der Gegner ist natürlich meist schneller an der Maus oder geistesgegenwärtiger mit den vorab einstellbaren Zügen und holt seinen früheren Zeitrückstand immer mehr auf. Man hat noch 3 Sekunden, der Gegner nur noch eine. Man ist am Zug, zögert noch einen Moment und klickt dann den Springer, die Dame, den Turm an, um unmittelbar mattzusetzen. Da haucht eine Stimme aus dem Programm sowas wie „Hasta!“ in mein linkes Ohr (ich trage Kopfhörer beim Spiel). Unweigerlich erschreckt man, wir erinnern uns, ich hatte noch drei Sekunden. Davon eine gezögert, bleiben 2. Eine weitere vergeben wegen „Hasta!“, der buchstäblichen Schreck-Sekunde, bleibt noch eine. Durch den Schreck kommt meine Hirn-Hand-Koordination ins Wanken, die bereits angeklickte mattsetzensollende Figur, die schon in Richtung Mattsetzfeld bewegt wird, wird losgelassen („wehe wenn sie losgelassen!“ sagt das geflügelte Wort völlig zu Recht), wird losgelassen also noch just in time – aber auf dem falschen Feld. Mit dem Finger auf der Maus bin ich ausgerutscht, wie damals Bettina von Storch angeblich bei einem ihrer anrüchigen Kommentare in einem „sozialen“ Medium, der Gegner zieht nun irgendwas und das Programm läßt mir danach großzügig vielleicht noch vier Hundertstel Sekunden, bevor es „Time“ und „0:1“ auf den Bildschirm schreibt, zwanzig Minuten Schwerstarbeit sind perdu, vorzugsweise auch noch gegen einen Gegner mit fünfhundert Elo weniger.
Es gibt zum Ausgleich aber auch sonnige Momente: Führt man in einer Partie einen Gewinnzug aus, dann kommentiert das Programm dies oft mit einer gepfiffenen Halbzeile aus der Marseillaise, der französischen Nationalhymne. „Auf, Kinder des Vaterlandes“ (so hieße der Text ins Deutsche übertragen) wird akustisch-melodisch vorgegeben, in seinem fröhlichen Optimismus so ansteckend, dass man Gefahr läuft, übermäßig euphorisiert das Spiel noch zu vergeigen. Vor allem aber wird man animiert, mit der im Lied folgenden Halbzeile zu antworten. Wer also in Bus oder Bahn sitzend sein Gegenüber am Smartphone daddeln sieht, mit Stöpseln im Ohr und ihn plötzlich die Melodie zu „Der Tag des Ruhmes ist gekommen“ pfeifen oder singen hört, der kann sich ziemlich sicher sein, dass von ihm gerade bei chessbase ein Gewinnzug eingegeben wurde.
Kommen wir zum Schluss zurück zu unserem eingangs erwähnten bedauernswerten Joe, dem Todeskandidaten. Ob unter meinen Gegenspielern aus den USA tatsächlich mal einer dabei war, werde ich, werden wir nie erfahren. Sollte es dennoch mal so gewesen sein – und sei es in einer der oben erwähnten Zeitnotschlachten - und ich hätte gegen ihn verloren in seiner letzten Stunde, so will ich mich darob nicht grämen, sondern vielmehr denken: ich habe wohl getan und Joe ist zufrieden von uns gegangen mit seinem neuen Elo-Kontostand von 2500. Und vielleicht ist zwar sein T-Bone-Steak dabei kalt geworden, nicht jedoch sein Fall: Vielleicht hat ihn der Gouverneur ja begnadigt und vielleicht haben engagierte Bürgerrechtsanwälte seinen "cold case" wieder aufgerollt, einen korrupten Bezirksstaatsanwalt überführt, der auf Kosten von Joes Verurteilung seine Wiederwahl sichern wollte und haben gleichzeitig einen anderen, wahren Täter ermittelt. Und der dann haftentlassene Joe kann nach acht Jahren in der Todeszelle nun in Freiheit einen neuen Elo-Rekord in Angriff nehmen.